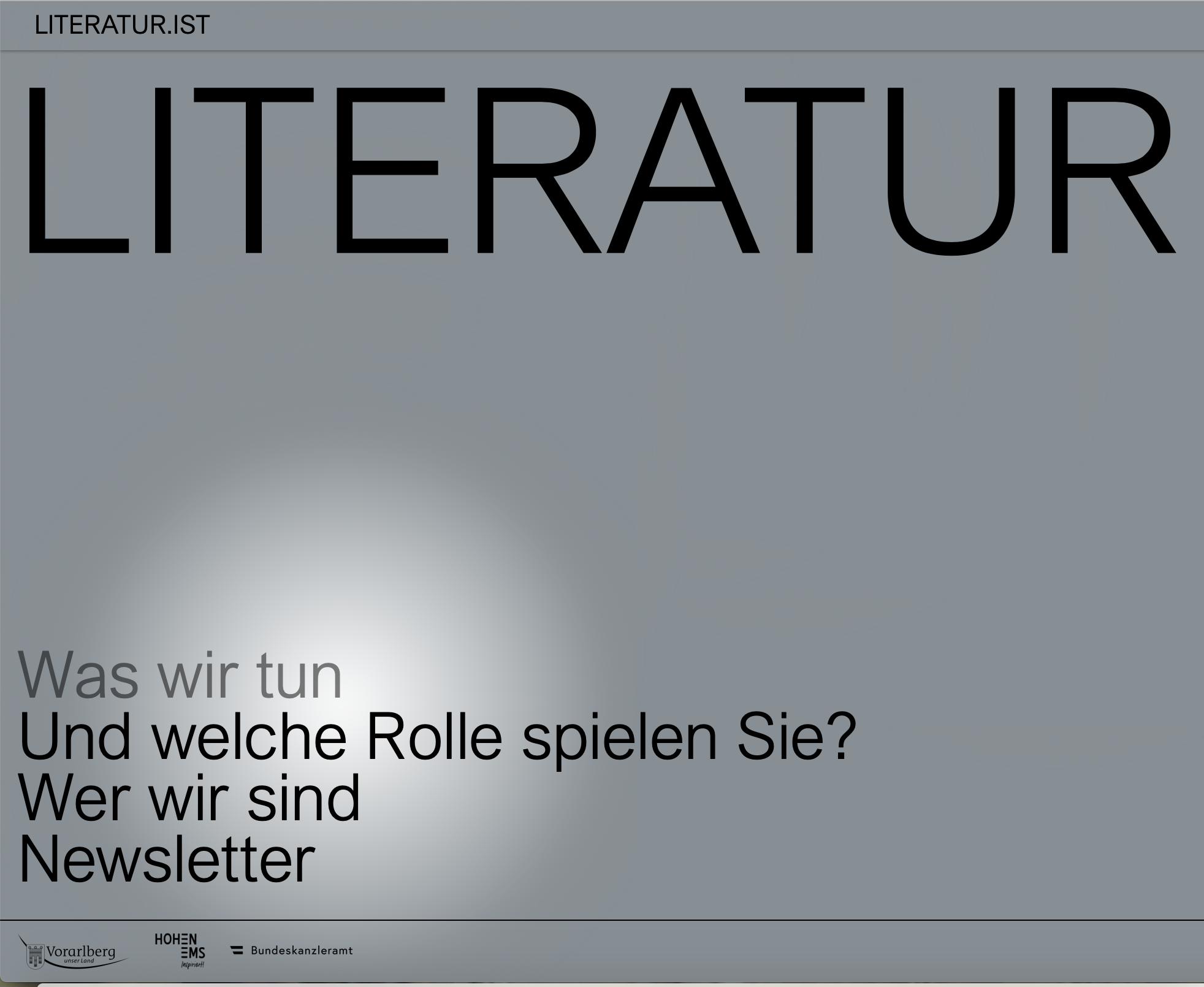Cara Roberta.
Alles ist gut
Essay
ALLES IST GUT
Auf dem Küchentisch liegt ein Buch mit dem Titel „Wie man sich die Welt erlebt“. Ich habe es nicht gelesen, einem ersten Eindruck folgend geht es aber in etwa darum, im Alltäglichen das Besondere, das künstlerische Potenzial zu entdecken, ganz einfach, indem man seinen Blickwinkel verändert und sich die Zeit nimmt, die Dinge etwas länger zu betrachten, als man es vielleicht gewohnt ist. Das Buch gehört V., sie verwendet es gelegentlich für den Unterricht. V. ist Kunstlehrerin. Aber vielmehr noch ist sie das, was man landläufig eine Lebens-künstlerin nennt. V. ist meine Antithese. Sie zählt zu jener Art Menschen, die kein schlechtes Wetter kennen, sondern nur Kleidung, die nicht von Gore Tex ist. Für V. ist jenes meistgereichte Glas der Welt (was man in Zeiten wie diesen besser lassen sollte) stets halbvoll, während ich permanent ans Nach-schenken denke. V. sagt nicht, alles wird gut, sondern alles ist gut, und sie meint es auch so. Wahrscheinlich bin ich ein Zweckpessimist. Und werde es bleiben. Bis ans Ende meiner Tage. (Die selbstredend gezählt sind.) Oder ich lasse es einfach bleiben. Nehme das Buch in die eine und das Kind in die andere Hand und gehe hellhörig und -sichtig meiner oder unserer Wege durch eine seit vergangener Woche per Verordnung unter Quarantäne stehende Ortschaft. Leihe dem nach und nach erstarkenden Zukunftsfrohen an meiner Seite ein Ohr: Im Grunde ist dieser mal mehr, mal weniger virulente Kulturpessimismus nichts als eine überholte Erfindung, ein Atavismus, ähnlich unserem als Schwanzrest unverhältnismäßig ausgeprägten Steißbein. Nutzlos. Ein Relikt aus Zeiten, da es noch von Vorteil sein konnte, immer vom Schlimmsten auszugehn. –
Wohlan, unsere an Sehenswürdigkeiten ansonsten eher arme Gemeinde hat jetzt also ihre Attraktion: Straßensperren. Und sie werden auch bestaunt. Naturgemäß zurzeit aber nur von Einheimischen. (Was nicht im Sinne der Vorarlberger Tourismus-strategie sein kann.) Ein Polizist in Warnweste und mit Mundschutz kommt auf uns zu. Zu meiner Überraschung jedoch nicht, um uns unsere Grenzen aufzuzeigen, sondern um in gebotener Distanz einen Plastikreflektor in Gestalt eines Bären zu überreichen. Der Polizist sagt, schau mal, ein Bär, der leuchtet im Dunkeln, während ich einem seltsamen Instinkt folgend für das Kind simultan übersetze. Im nahezu selben Wortlaut, versteht sich. Das Kind freut sich. Alles ist gut. Und so viel stiller. Auch weil der Schwerverkehr zum Erliegen gekommen ist. Seit der Ansiedlung eines Entsorgungs- und Abbruchunternehmens vor ein paar Jahren hat dieser deutlich zugenommen. Vorteilhaft für das Unternehmen, weniger vorteil-haft für die Anrainer. Vielleicht, spricht der sich immer selbstbewusster gerierende Optimist in mir, nein, ganz bestimmt will uns die derzeitige Situ-ation auch das mitteilen: Geht’s allen gut, geht’s der Wirtschaft gut. – Aber Stille, das ist relativ. Zumal hier am Land. Vielmehr ist es der Stillstand, der Kardinalfrevel im Fortschrittskatechismus, aus dem eine Ruhe erwächst ohnegleichen. Und mit der muss man erst einmal umgehen können. Wie mit so manch anderem auch. Vieles ist Neuland, das Wenigste Teil unseres Erfahrungsrepertoires. Der temporäre Eingriff in die Grundrechte. Die monothematischen Nachrichtensendungen. Der Umstand, dass dem in aller Regel mit einer Statistenrolle bedachten Gesundheitsminister mehr Sprechzeit zugestanden wird als dem Chefkanzler. Die Unwahrscheinlichkeit, dass unter italienische Verhältnissen etwas anderes als süßes Nichtstun verstanden werden könnte. Die Erkenntnis, Franzosen horten in Krisenzeiten Rotwein und Präservative, der gemeine Öster-reicher hingegen Klopapier. Oder die eigentliche Unmöglichkeit eines plötzlichen Konsenses über Parteigrenzen hinweg: Nicht auszudenken, dass wir in Nach-Corona- Zeiten wieder in die alten, jede Aussage verweigernden Enthaltungsmuster zurück-fallen. Noch ist er also nicht zur Gänze verstummt, der Miesepeter. Die Zukunftsschau des erstandenen Optimisten indes ist die einer Langzeitwetterprognose, vage, aber nicht aussichtslos: Etwas wird sich ändern.
Einstweilen gehen wir wieder unserer Wege. Der Himmel über uns wolkenlos und weit, aber unnahbar wie noch selten einmal. Wir unterqueren den Bahnhof, an dem bis auf Weiteres kein Zug mehr hält. Passieren die gedeckte Holzbrücke, die buchstäblich über Nacht geschlossen wurde. Schreiten den steinigen Weg hinunter zum Fluss-ufer. Das Flussufer ist ein Spielplatz auf Zeit. Jedenfalls für jene, die keine Neverland Range en miniature im Garten haben. Oder – noch prekärer – überhaupt keinen Garten haben. Wir haben einen Garten. Trotzdem: Das Flussufer ist schön. Und so anregend pluralistisch. Vom Felsbrocken bis zum Sandkorn – alles da. Ein lithogenes Beispiel für ein friedliches Nebeneinander. Das Kind wirft sich auf den Boden und säuselt mit dreiviertel-geschlossenen Augen „Aber heidschi bumbeidschi bumbum“. Ich sollte es zum Aufstehen bewegen, ein kühler Wind geht. Aber ich lass es. Fürs Erste jedenfalls. Alles ist gut.
Beim stillen Schauen in die Weite
Essay
BEIM STILLEN SCHAUEN IN DIE WEITE
Über geistige Flexibilität
Der Begriff „Flexibilität“, erinnere ich mich, wurde uns in der Oberstufe eingeimpft, eingetrichtert ist er uns worden mit hypnotischem Nachdruck – sei flexibel: das ewige Mantra der Fortschrittsgut-gläubigen. Eine der Verabreicherinnen dieses neurotoxischen, weil auf die Nerven gehenden Serums war unsere Wirtschaftskundelehrerin, eine gegen Humor gestählte Mittvierzigerin, die die Nase stets hoch über ihrem unfreiwilligen Auditorium trug, Teil eines von den Schülern gefürchteten Professorinnen-Trios mit verstaubten Röcken und ebensolchen Ansichten war, und die auf – zugegeben nicht immer hundertprozentig themenbezogene – Zwischenfragen so flexibel reagierte wie ein Seehund, dem man anstatt des Balles einen Kegel zuwirft. Bis heute ist Flexibilität ein Schlagwort, das sich hält mit der Unbeirrbarkeit eines Langzeitdespoten. Ein Wort, das stets top-gereiht ist beim Anforderungsprofil noch fast jeder Stellenausschreibung und jedenfalls in diesem Kontext im Verdacht steht, nichts weiter zu sein als ein simpler Euphemismus für ständige Verfüg-barkeit. Die Flexibilität hat’s weit gebracht. Vermutlich auch dank einiger Lehrkörper mit dem pädagogischen Feingespür von Qualitätsmanagern. Dass allerdings der Begriff häufig im Sinne eines fragwürdigen Berufsethos verstandenen wird, ist nur ein Aspekt. Ein anderer: die fast vollständige Ausklammerung der geistigen Flexibilität (obwohl sich beide – die geistige und die physische – naturgemäß nie ganz voneinander trennen lassen). Gerade vor dem Hintergrund einer weit verbreiteten Wirtschaftshörigkeit verwundert das aber nicht weiter: Die physische hemmt die geistige Flexibilität, und genau das soll sie auch. Oder umgekehrt: Die geistige Flexibilität wächst mit abnehmender physischer Bieg- und Beugsamkeit. Jeder kann das selber ausprobieren. Selbst wenn anfangs die Möglichkeit besteht, dass die Welt nichts ist als ein Echo auf die eigene Sprachlosigkeit, so ungewohnt ist die Wahrnehmung ohne diese Bilder- und Beschallungspermanenz, der wir ausgesetzt sind. Möglich ist aber auch, dass man – vielleicht mit dem Stummschalten des Mobiltelefons – plötzlich hell- und dunkelhörig wird, empfänglich für die leuchtenden wie die düsteren Töne und die dazwischen; dass sich mit einem Mal der Gesichtskreis weitet, wenn man nicht mehr gezwungen ist, den Blick über das Steuer auf die Mittelleitlinie zu richten, sondern sich einem durch das Zugfenster Weit- und Vielsichten eröffnen noch und noch, und man gerade jetzt im Sommer merkt, wie einem die Augen übergehen angesichts einer mit jedem Schauen scheinbar immer grüner werdenden Landschaft, wie es überall nur noch so sprießt und farnt, als würde man Zeuge einer zeitgerafften Radiation der Pflanzenwelt, wildwüchsig, landgreifend… Manchmal genügt es auch schon, zum Überzeugungsmittäter zu werden und sich der Welt ein wenig mehr mit Kinderaugen anzunähern. Ich erinnere mich beispielsweise, wie ich an einem Frühjahrstag einmal bei einem Spiel des örtlichen Fußballvereins hinter dem Tor gestanden habe, das Kind in meiner Armbeuge, hundemüde, aber unfähig, in den Schlaf zu finden, und mit jedem Augenaufschlag in dieses Weltunbekannte bloß ein wenig mehr vor Erschöpfung das Köpfchen hängen lassend. In dem Moment, als ich den Eindruck hatte, dass sein Blick endlich in den Traumschatten gleiten würde, war es der jähe Torjubel, der uns beide aufhorchen ließ: das Kind, das beim Anblick des jubilierenden, flieger-gleich mit ausgestreckten Armen auf die Zuschauer zulaufenden Schützen mit einem Mal hellwach verzückt war, und mich, der ich nicht nur von dieser Freude unerwartet angesteckt, sondern zu einer plötzlichen Überzeugung gelangt war, zu einer Ein- oder auch Zuversicht, die mich – wenn auch nur für den Moment – rufen ließ (und zwar nicht nur mir selbst in Erinnerung): So muss es sein! Offenen Auges und erhobenen Herzens in den Tag… Und obwohl wir dann unseren Heimweg nur leicht verändert begingen, bot jeder neuerliche Schwenk, jedes gewohnheitswidrige Straßen-Queren ungeahnte Einblicke, getragen von eben diesem Sichten, diesem einsichtig und zuversichtlich Sein. Wie zum ersten Mal fiel uns der Flug der Schwalbe ins Auge, so verspielt gemütserwärmend war er, dass man es nicht glauben möchte: Eine Schwalbe soll noch keinen Sommer machen! Ein Premierenbild auch der Blick in einen Garten samt einer an einem starken Ast angebrachten Schaukel, die von einem Luftzug angerührt sich sachte hin und her bewegte und so zur stillen Aufforderung geriet. Ich stelle mir sogar vor, dass es uns für ein Mal gelang, das je nach Windgang wahrnehmbare Tönen von der Autobahn in ein kosmisches Rauschen zu verwandeln, ein Rauschen, das einen gänzlich unerhörten Urlaut in uns zum Klingen brachte, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben…
Es sind die Gewohnheitsbewegungen, denke ich mir, die mich zwar auf der Bahn halten, aber eben auf einer solchen, die bloß pflichtschuldig um die täglichen Vernichtungen kreist – allzu schnell vergesse ich um die Fliehkraft des Still-in-die-Weite-Schauens, der gelassenen Untätigkeit, des grundlosen Auflachens.
Im Buddhismus heißt es, man soll jeden Tag einen Ort aufsuchen, an dem man noch nie gewesen ist. So könnte das Mantra für die geistig Flexiblen lauten. Die physische Beweglichkeit gleich miteinbegriffen.